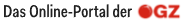WK-Wahl: Wirtschaftsbund verliert, Freiheitliche legen zu
Geringe Wahlbeteiligung, massive Verluste für den Wirtschaftsbund und Zuwächse für die Freiheitlichen: Die Wirtschaftskammerwahl 2025 hat Bewegung in das Machtgefüge der Unternehmervertretung gebracht.
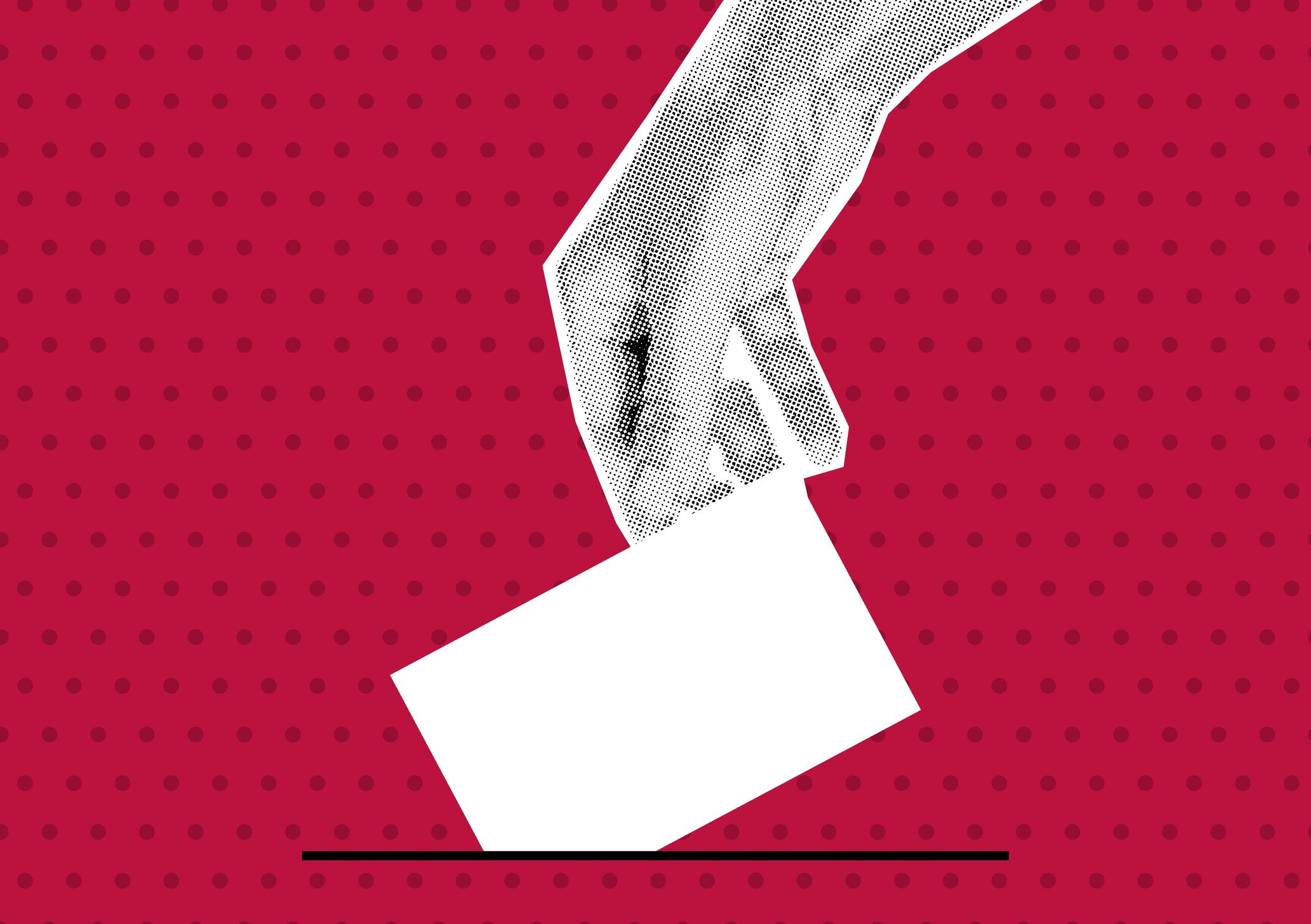
Die Ergebnisse der Wirtschaftskammerwahl 2025 zeigen einen klaren Trend: Der ÖVP-Wirtschaftsbund (ÖWB) bleibt zwar dominierend, verliert aber deutlich an Zustimmung. Mit 61,3 Prozent der Stimmen büßt er 7,9 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl ein. Besonders stark profitiert davon die Freiheitliche Wirtschaft (FW), die ihren Stimmenanteil mit 13,6 Prozent (+7,3 Prozentpunkte) fast verdoppelt.
Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) kommt auf 9,7 Prozent (-1,1 Prozentpunkte), die Grüne Wirtschaft (GW) auf 8,4 Prozent (-1,1 Prozentpunkte). Die liberalen UNOS können hingegen auf 5,3 Prozent (+2,6 Prozentpunkte) zulegen.
Mandatsverteilung und Wahlbeteiligung
Trotz der Verluste dominiert der Wirtschaftsbund weiterhin und sichert sich 6.197 der insgesamt 9.000 Mandate. Die FW stellt 959 Mandate, der SWV 743, die GW 488 und die UNOS 222.
Besonders auffällig ist der Rückgang der Wahlbeteiligung: Nur 26,5 Prozent der Kammermitglieder gaben ihre Stimme ab – ein Minus von 7,2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Am geringsten fiel die Beteiligung in Vorarlberg mit nur 15,7 Prozent aus.
Regionale Unterschiede
In mehreren Bundesländern zeigt sich ein ähnliches Muster: Der Wirtschaftsbund verliert an Zustimmung, während die Freiheitliche Wirtschaft deutliche Zugewinne verzeichnet.
- Kärnten: Der ÖWB hält mit 67,1 Prozent die Mehrheit, verliert aber fast zehn Prozentpunkte. Die FW gewinnt über zehn Prozentpunkte hinzu und erreicht 17,8 Prozent. Ein Skandal überschattet das Ergebnis: In Kärnten gab es Manipulationsvorwürfe, weil Kandidaten angeblich ohne ihr Wissen auf Wahllisten gesetzt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
- Oberösterreich: Der ÖWB rutscht um 9,7 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent ab. Die FW legt um 8,7 Prozentpunkte zu und erreicht 17,7 Prozent.
- Tirol: Der Wirtschaftsbund hält 69,7 Prozent, verliert aber rund zehn Prozentpunkte. Die FW verdoppelt ihren Stimmenanteil auf 14,8 Prozent.
- Salzburg: Besonders schmerzhaft für den Wirtschaftsbund: Minus 12,93 Prozentpunkte, doch mit 58,17 Prozent bleibt er stärkste Kraft. Die Freiheitlichen steigern sich von 5,26 auf 13,49 Prozent.
- Steiermark: Auch hier ein ähnliches Bild: Die FW verdoppelt sich auf 16,6 Prozent, der Wirtschaftsbund fällt auf 59,1 Prozent.
- Burgenland: Ein Sonderfall: Der Wirtschaftsbund gewinnt hier sogar 5 Prozentpunkte und kommt auf 75,22 Prozent. Dennoch verdoppelt sich auch hier die FW auf 6,9 Prozent.
- Niederösterreich: Der ÖWB erzielt 64,21 Prozent, die FW 13,57 Prozent, der SWV 10,44 Prozent.
- Vorarlberg: Hier traten ÖWB und FW gemeinsam mit der Liste „Vorarlberger Wirtschaft“ an und erreichten 87,1 Prozent – ein leichtes Plus gegenüber 2020.
Kritik am Wahlsystem
Die Wirtschaftskammerwahl findet traditionell unter geringer öffentlicher Aufmerksamkeit statt. Doch diesmal sorgen mehrere Berichte für Unmut:
- Das Magazin Profil deckte auf, dass Fraktionen massenhaft Wahlkarten für Mitglieder beantragten und damit wertvolle Daten sammelten.
- Das Momentum-Institut berichtete, dass ein Wirtschaftsbund-Funktionär im Burgenland trotz Wahlfälschungsvorwürfen erneut antreten durfte.
- Der Standard berichtete über einen Unternehmer, der kurz vor der Wahl mehrere Firmen anmeldete, um so angeblich seine Stimmen gegen Gegenleistungen zu verkaufen.
In allen Fällen gilt die Unschuldsvermutung.
Neben diesen Vorfällen steht auch das Wahlsystem selbst in der Kritik. Kammermitglieder können nur auf unterster Ebene – in ihren Fachgruppen – direkt abstimmen. Die mächtigsten Positionen werden dann indirekt vergeben, meist durch den Wirtschaftsbund, der fast überall mehrere Kandidaten ins Rennen schickt. Kleine Fraktionen haben oft nicht genügend Bewerber für alle Fachgruppen, was ihre Chancen stark einschränkt.
Ein weiteres Problem: Friedenswahlen. In vielen Branchen kandidiert nur eine einzige Liste, die Mandate werden dann intern verteilt – ohne Wahl. Besonders in den Kammersparten Industrie und Bank & Versicherung ist das üblich.