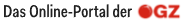Tourismus neu denken: Zwischen Vision und Wirklichkeit
Das Tourismus-Symposion der WKÖ in Stuben am Arlberg präsentierte Anfang April „Challenges 4 Tourism“. Vortragende aus Glaziologie, Tourismus und Ökonomie teilten ihre Erkenntnisse und Zukunftspläne.

Innovationen sind ein Hauptthema im Tourismus. Laut Definition gibt es sie ja ständig, ob kleinere oder größere. Oftmals heißt auch eine ganz „natürliche“ Veränderung gerne „Innovation“, so dass der Ausdruck bereits 2014 vom Wallstreet Journal zum Unwort des Jahres gekürt wurde. Wie steht es nun im Tourismus in Österreich – ist alles bestens oder gibt Innovationsbedarf? Mit dieser Fragestellung eröffnete Bundesspartenobmann Robert Seeber das Tourismus-Symposion.
„Die Forderung nach Innovationen entsteht aus der Notwendigkeit, sich zu differenzieren. Es geht um eine Adaption an die veränderten Verhältnisse und neuen Erwartungen der Gäste“, erklärte die Tourismus-Professorin der FH Salzburg, Eva Brucker. Sie präsentierte in ihrem Bericht international besonders innovative Tourismus-Destinationen – und Österreich schlägt sich hier recht gut.
Das macht Mut und regt an, noch mehr zu tun. Als wichtigen Punkt nannte sie den vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich einer individualisierten Urlaubsplanung. Durch Hyperpersonalisierung wird alles passgenau auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Idealerweise werden potenzielle Crowding-Ereignisse beachtet. Wenn eines der bevorzugten Programme oder Events überlaufen ist, steht zeitnah ein attraktives Alternativprogramm zur Verfügung. Situationen wie etwa letzten Winter bei überfüllten Weihnachtsmärkten in Wien wären dann Schnee von gestern.
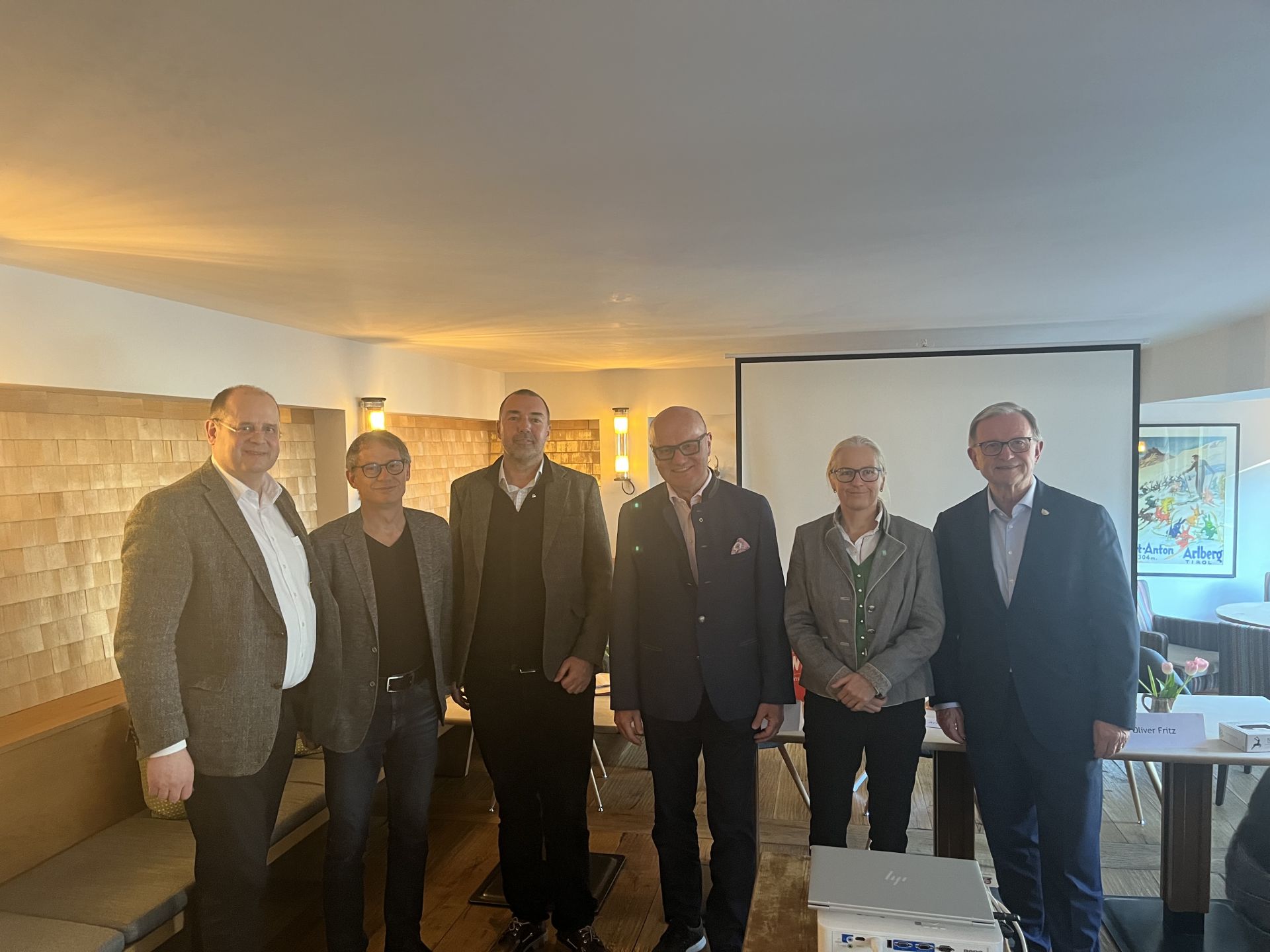
Megatrends KI und Nachhaltigkeit
Dieser vermehrte Einsatz der künstlichen Intelligenz kommt im besten Fall der sozialen Interaktion zugute, so dass für persönlichen Austausch wieder mehr Zeit ist. Denn, so die Tourismusforscherin, viele Dinge, die alltägliche Routinen sind, lassen sich auf automatisierte Prozesse umlegen und können von der KI erledigt werden. Soweit jedenfalls die optimistische Theorie. Ansätze gibt es schon längst, je nachdem, um welche Destination es sich handelt, sind die Angebote der KI Planung mehr oder weniger ausgebaut. Der Trend zu einem verstärkten Einsatz zeichnet sich jedoch ab.
Digitale Transformation und Nachhaltigkeit nennt Eva Brucker als die wichtigsten Trends, und Nachhaltigkeit muss im Gesamtpaket des touristischen Angebots bereits enthalten sein. Sie darf kein Add-on sein, wie bisher, wo es eher um Reduzierung der negativen Auswirkungen ging als um neue positive Ansätze. Sie muss im Gesamtpaket integriert sein – was logisch ist, wenn man sich als Destination über Faktoren wie schöne Landschaft, gute Luft und funktionierende soziale Strukturen definiert. Das „Lebensraumkonzept“ gilt als neues Verständnis von Destinationsmanagement.
Integration von Nachhaltigkeit muss immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden. Und Tourismus soll mehr mit Qualität zu tun haben, als mit Quantität. Dazu gehört ein ausgewogener, personalisierter Urlaub, der den Interessen und dem Können angepasst ist.
Ganzjahrestourismus
Ein weiterer wichtiger Punkt, den man unter die Innovationen einreihen könnte, ist das Umdenken der reinen Winter- und Skidestination auf den Sommertourismus. Gerhard Lucian, Bürgermeister von Lech, erklärt wie dieser Anspruch schon seit einiger Zeit vermehrt umgesetzt wird. Mit gezielten Programmen lockt man Sommergäste an – nicht nur mit dem Klassiker Wanderungen, sondern auch mit Events und Sportmöglichkeiten, sodass eine kontinuierliche Attraktivität der Region gegeben ist. „Neue Mountainbike-Strecken sind ein Beispiel“, sagt Lucian. Wichtig ist hier, dass weitere Eingriffe in natürliche Habitate von Tieren und Erschließung von Naturraum, die Identität dieser Landschaft und der ganzen Atmosphäre ausmachen, dabei möglichst vermieden werden. „Für die Radstrecken wird man bestehende Wege präparieren“, heißt es auf Nachfrage. Denn wenn Natur und Landschaft zur Charakteristik des Zielortes gehören, wäre ihre Verminderung wiederum eine Bedrohung für die Qualität des touristischen Produkts.
Joschi Walch setzt indes mit seinem experimentellen Kochlabor in der Roten Wand auf innovative, kulinarisch geprägte Events: „Wir haben eine Person engagiert, die in der Gegend nach essbaren Pflanzen sucht. Und laden Menschen ein, die uns interessieren, um uns von ihnen inspirieren zu lassen.“ Die Speisekammer ist mit regionalen Produkten gefüllt, die Häuser mit regionaler Textilfabrikation und Handwerk ausgerüstet. Man setzt auf Verbundenheit mit der Region.
Gletscher ade
Gletscher waren bisher identitätsstiftend für Schneegarantie und Wintersport. Ein wenig überraschte es daher, von der Glaziologin Andrea Fischer zu hören, ein schnelles Abschmelzen der Gletscher sei sogar wünschenswert. Um so schneller könne die Transformation umgesetzt werden, die für ein Aufrechterhalten der Infrastruktur für die Winter-Destinationen nötig sei. Anstatt nun in Überdramatisierung zu verfallen, sei es pragmatischer, sich mit den veränderten Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und das Beste daraus zu machen. „Es geht immer darum, wie geht man mit dem Klimawandel um. Das Zauberwort heißt Kulturtechnik.“
Areale, die momentan noch für den Wintersport geeignet sind, werden zum Teil verschoben. Die Umdeutung der aktuell krisenhaften Situation in eine Möglichkeit der Erneuerung erzeugt zwar Handlungsbereitschaft, dennoch bleibt zu überlegen, welchen Einfluss die weiteren massiven Eingriffe im Hinblick auf das Image einer intakten Naturlandschaft hat, die Teil des Marketing-Narrativs sind. Diese gilt als touristisches Gut, das es zu erhalten gilt. Die Glaziologin bleibt gelassen: „Die Vegetation geht nach oben. Das heißt, es werden keine kahlen Hochgebirgslandschaften sein. Man kann sich eine Attraktivierung der Hochgebirgslandschaft vorstellen mit neuen Seen, mit neuem Grün.“
Entwicklung des Tourismus in Österreich
Was der Tourismus gesamtwirtschaftlich bedeutet, fasste Oliver Fritz vom Wifo in Zahlen. Nach dem herben Rückgang in der Pandemie hat sich gezeigt, dass der Pessimismus unrecht hatte. 154,3 Millionen Übernachtungen wurden im Jahr 2024 für ganz Österreich gemeldet – mehr als vor der Pandemie, wobei die Länge der Anzahl der Nächtigungen am Stück seit Mitte der 70er Jahre sich um die Hälfte reduziert hat. „Man macht öfter, aber dafür kürzer Urlaub. Wien wird gestürmt – entgegen den Prognosen, hier werde es besonders schwierig sein“, erzählt der Forscher. Die Frage liegt nahe, ob es in Wien nicht schon zu Overtourism kommt. In den Skiregionen zeigt sich ein Anstieg von Gästen aus den USA, Tschechien, Polen und Ungarn, wobei weiterhin die meisten aus Deutschland und den Niederlanden kommen.